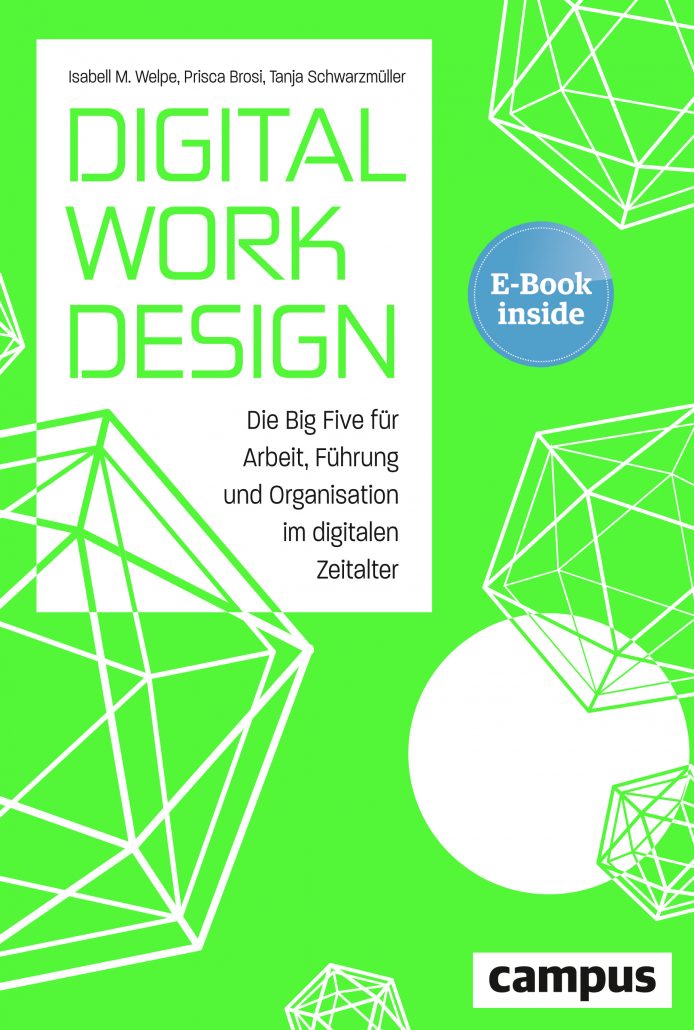Die digitale Organisation muss demokratisch sein und die Gesundheit fördern
Mit den „Big Five Erfolgsfaktoren“ für den Switch zur digitalen Organisation legen Isabell M. Welpe, Prisca Brosi (beide TU München) und Tanja Schwarzmüller die Messlatte für die Bewertung ihres Buchs hoch. Gilt doch das Fünf-Faktoren-Modell (Big Five) als Standardmodell in der Persönlichkeitsforschung.
Nach Welpe, Brosi und Schwarzmüller können Unternehmen den Übergang zur digitalen Organisation erfolgreich gestalten, wenn in ihnen
(1) der Umgang mit der VUCA-Welt zur Kernkompetenz wird,
(2) durch unterschiedliche Arten von Teamarbeit Disruptionen gefördert werden,
(3) sie demokratischer werden,
(4) die Bedeutung von internen wie externen Beziehungen erkannt und gefördert wird sowie
(5) das Thema Gesundheit stärker in den Fokus rückt.
Evidenzbasierte Handlungsempfehlngen
Diese Erfolgsfaktoren, die in dem Buch „Digital Work Design. Die Big Five für Arbeit, Führung und Organisation im digitalen Zeitalter“ (2018, Campus) hervorragend lesbar in weitere Teilaspekte aufgegliedert werden, seien aus „der aktuellen wissenschaftlichen Literatur“ abgeleitet.
Entsprechende Handlungsempfehlungen für Mitarbeiter, Führungskräfte und Organisationen seien „evidenzbasiert“, so die Autorinnen zur ihrem Anspruch. Am Ende legen diese einen „10-Punkte-Plan“ vor, um mit diesem bei der Umsetzung der fünf Erfolgsfaktoren zu unterstützen.
Zentrale Dimensionen bei der Demokratisierung (3) der Unternehmen sind „Empowerment“ und „Partizipation“.
Dazu Tanja Schwarzmüller im Gespräch (siehe Rainer Spies, Mitbestimmung 4.0 – Entscheidungen beschleunigen, Mitarbeiter beteiligen, in „Personalführung“, Heft 10 / 2018):
„Mitarbeiter müssen in ihrem Aufgabenbereich mehr Entscheidungs- und Gestaltungsmöglichkeiten bekommen, sie müssen stärker als bislang in Entscheidungsprozesse im Unternehmen einbezogen werden und es dürfen keine Informationsmonopole mehr bestehen“, sagt Schwarzmüller.
„Autonomie“, „Partizipation“ und „Transparenz“ müssten strukturell ermöglicht werden und die Mitarbeiter müssten sich „ermächtigt fühlen“, tatsächlich auch mitzuwirken. Warum?
„Durch die mit Digitalisierung einhergehende Komplexitätserhöhung wird es für Führungskräfte zunehmend schwieriger, ihre Mitarbeitenden im Detail anzuleiten. Gleichzeitig müssen Unternehmen sehr schnell auf Veränderungen in ihrer Umgebung reagieren“, sagt Schwarzmüller. Das funktioniere besser, wenn Entscheidungen dezentral getroffen würden.
Ist Partizipation mehr als Mitbestimmung?
Ihr Verständnis von interner Demokratie sei „umfassender“ als das im Rahmen der formellen Mitbestimmung, meint Schwarzmüller. Diese Auffassung lädt zur Kritik ein.
„Aus der rechtspolitischen Perspektive besteht die Notwendigkeit, unabhängig vom ´good will´ einer effizienzorientierten oder fürsorglichen Führungsebene Teilhabe und Mitgestaltung der Beschäftigten vorzuhalten“, springt Professor Richard Giesen, Direktor am Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht (ZAAR) an der LMU München, für die institutionalisierte Mitbestimmung in die Bresche (Spies, 2018).