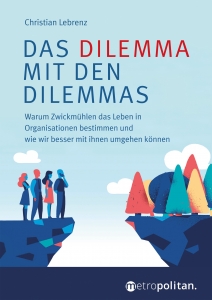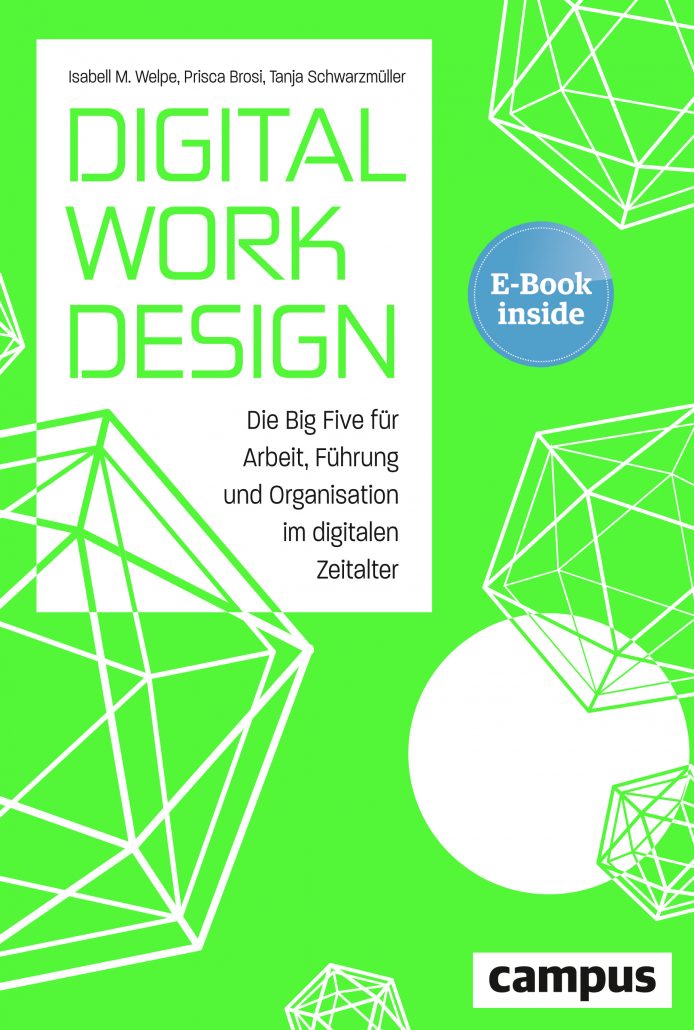EdTech und Learning Analytics – Möglichkeiten und Grenzen
Lernempfehlungen, adaptives Lernen und Learning Analytics (LA): Diese Begriffe sind in der Aus- und Weiterbildungsbranche derzeit in aller Munde. Doch was steckt hinter diesen Anwendungen und wie „reif“ sind sie in der Anwendung?
Die Anbieter rühren diesbezüglich kräftig die Werbetrommel, viele Anwender sind jedoch noch zögerlich. Experten aus der Aus- und Weiterbildung nehmen Stellung zu den Potenzialen der neuen Technologien.
Was früher Bildungscontrolling oder Lernerfolgskontrolle genannt wurde, heißt heute Learning Analytics (LA) oder Educational Data Mining (EDM). Und KI-basierte Systeme versprechen sogenanntes „adaptives Lernen“ und automatisch generierte personalisierte Lernempfehlungen, die im Dschungel der Weiterbildungsangebote genau das Richtige für den Lernenden finden und ihm helfen sollen, schneller und effizienter sein Lernziel zu erreichen. Dabei helfen sollen auch Chatbots, deren Anbieter für diese sogar Anwendungsmöglichkeiten im Coaching sehen. (Können Chatbots coachen?)
Emotionen und unbekannte Intentionen: Was Chatbots nur bedingt „erkennen“ können
„Die Anwenderseite hat sich im deutschsprachigen Raum bisher eher zögerlich gezeigt“, sagt Dr. Cäcilie Kowald, Learning Designerin bei Time4you. Dies sei bei technologischen Neuerungen in der Aus- und Weiterbildung seit jeher zu beobachten. Eine gewisse Skepsis gegenüber den neuen Technologien kann Kowald jedoch nachvollziehen; insbesondere dann, wenn seitens der Anbieter von künstlicher Intelligenz die Rede ist.
So hätten etwa Chatbots nun einmal technische Grenzen. „In Maschinen kann man nur das einbauen, was bereits entschlüsselt ist. Emotionen können Chatbots jedenfalls nur sehr bedingt erkennen“, sagt Kowald. Time4you bietet Tools für das Erstellen von Chatbots an. Anders als ein „herkömmlicher“ digitaler Assistent reagiert ein von Time4you gebauter Bot nicht allein auf Befehle, sondern führt Dialoge, beispielsweise über Lerninhalte. Das Ganze beruhe auf einem regelbasierten System, erklärt Kowald.
„Regelbasiert“ heißt, dass der Bot nicht selbstständig „dazulernt“, wie das beim sogenannten maschinellen Lernen der Fall ist, sondern es wird vorab definiert, was der Bot zu verstehen und wie er zu reagieren hat. Bei Bedarf wird der Bot „händisch“ erweitert. „Entscheidend ist sowieso nicht die Technik, sondern die sprachlich-didaktische Aufbereitung von Inhalten und die Gestaltung der Dialogverläufe“, meint Kowald.
Etwas anders ist das bei „Ed the Bot“, der im „SAP Learning Hub“ zum Beispiel in Lerncommunities textbasiert Fragen der User beantwortet. Die SAP Learning Hub ist eine Weiterbildungsplattform für externe und interne technische SAP-Produktexperten. „Ed the Bot“ wird anhand großer Datenmengen trainiert und lernt selbstständig dazu (Machine Learning), um die Intentionen der Nutzer zu erkennen. Auch beim Finden von Kursen und beim Support hilft der Bot. Später soll er beim Selbst-Coaching eingesetzt werden, so die Pläne von SAP
„Unsere Bots lernen dazu, sind aber gleichwohl relativ simpel“, erklärt Thomas Jenewein, Digital Ambassdor bei SAP und ob der vielen Neuerungen des Softwareherstellers viel gefragter Bildungsakteur. „Unbekannte Intentionen der Lerner kann der Bot noch nicht erkennen“, stellt Jenewein klar.
Personalisierte Lernempfehlungen
Künftig sollen die Lernsysteme von SAP dem Nutzer auch personalisierte Lernempfehlungen geben und sogenanntes „adaptives Lernen“ ermöglichen. „Die Crux dabei sind erstens die Vorhersagemodelle und wie sie den Algorithmen antrainiert werden. Und zweitens müssen die Inhalte, die einem Lerner empfohlen werden, auch noch didaktisch, medial und inhaltlich gut sein. Sonst bringt das alles nichts: Garbage in, Garbage out“, sagt Jenewein.
Dr. Christoph Meier, Geschäftsführer am Swiss Competence Centre for Innovations in Learning (Scil) der Universität St. Gallen, erläutert in seinem Aufsatz „KI-basierte, adaptive Lernumgebungen“ genauer, wie Lernempfehlungen funktionieren. Demnach können Eintragungen im Benutzerprofil (Funktion, thematische Interessen et cetera), Analysen von Empfehlungen anderer Nutzer (Likes) oder algorithmenbasierte Textanalysen den Ausschlag für Empfehlungen geben.
Vorbilder für (Lern-)Empfehlungen sind große Plattformen wie Amazon oder Netflix. Allein das zeigt: „Man benötigt eine große Menge granular vorliegender Lerninhalte, um sinnvolle Empfehlungen geben zu können“, sagt der Bildungsinformatiker Dr. Martin Ebner.
Ebner hat an der TU Graz die Lernplattform I-Moox aufgebaut, die Weiterbildungen auf universitärem Niveau anbietet. Personalisierte Lernempfehlungen gibt es auf I-Moox nicht. „Wir haben das deaktiviert, weil wir für Empfehlungen, die dem User wirklich einen Mehrwert bringen, noch zu klein sind“, sagt Ebner.
Dieses Problem treibt auch andere Anbieter um. Um den Umfang maschinell kuratierter Lerninhalte zu erweitern, nutzt beispielsweise Sumtotal Systems Kooperationen mit unterschiedlichen Inhalteanbietern. Der gesamte Content wird in der Sumtotal-Bibliothek zusammengestellt und mithilfe des intelligenten Assistenten „Sia“ einem Lernenden je nach Bedarf empfohlen.
Lernender ist in diesem Fall der Mitarbeiter eines Unternehmens, der einen Text markiert und sich auf dessen Basis von Sia verwandte „Lernaktivitäten“ (Videos, Bücher etc.) zuweisen lässt. Dabei werden die „kontextuell relevantesten Ergebnisse“ angezeigt, sagt Doris Niederwieser, Costumer Sales Director DACH bei Sumtotal. Basis dafür sind die Benutzerprofildaten des Mitarbeiters, aber auch dessen Zugriffsrechte.
Wie funktionieren adaptive Lernsysteme? Top Secret!
Die Plattform Prüfungs.TV bereitet Azubis online auf Klausuren und Prüfungen vor und will in Zukunft „adaptives Lernen“ ermöglichen. Das bedeutet, dass das System den Lernenden nicht einfach nur Empfehlungen „ausspuckt“, sondern die Lerner bei der Zuweisung von Lernaktivitäten individuell bei ihrem jeweiligen Wissensstand „abgeholt“ werden. Die weiteren Lernschritte orientieren sich an dem, was der Lerner bereits kann und wie schnell er vorhergehende Lerneinheiten absolviert hat.
„Um die dafür nötigen Vorhersagemodelle und Algorithmen zu entwickeln, benötigen wir eine große Menge an Daten“, sagt Johannes Schulte, Geschäftsführer von Prüfungs.TV. Und damit das intelligente Lernsystem auch wissenschaftlich fundiert ist, kooperiert Prüfungs.TV mit einer Universität. Näheres ist (noch) nicht zu erfahren.
Der Grund: Adaptive Lernumgebungen sind sehr komplex, wie Christoph Meier vom Scil erläutert. Das System brauche Informationen darüber, was der Lernende bereits beherrscht und für welche weiteren Themen er bereit ist. Um den Wissensstand individuell zu diagnostizieren und Vorhersagen zu treffen, werden Wahrscheinlichkeitsrechnungen genutzt. Wenn eine Aufgabe vom Lernenden nicht gelöst wurde, müsse das System ergänzende Erläuterungen bereitstellen und weitere Aufgaben zuweisen – bis am Ende ein Teilthema als beherrscht gilt. Je nach Anbieter berücksichtigen adaptive Lernumgebungen auch mit, wie lange ein Lernender für die Bewältigung von Aufgaben braucht und wie sicher er sich dabei einschätzt.
Bildungsexperte Ebner warnt indes davor, die Potenziale solcher Systeme zu überschätzen: „Lernen ist ein sehr komplexer und ein sozialer Prozess, der pädagogisch-didaktisch nach wie vor nicht eindeutig geklärt ist.“ Mithilfe eines beständig optimierten adaptiven Lernsystems als Lerner schneller ein Lernziel erreicht zu haben, bedeute noch nicht, dass wirksamer gelernt worden sei.
Vom LMS zu Linkedin-Learning bei Boehringer Ingelheim
Auf eine große (Online-)Bibliothek mit mehr als 13.000 Kursen und mehr als 100.000 Videos lässt Boehringer Ingelheim (BI) seine Mitarbeiter zugreifen: Auf der Plattform Linkedin-Learning, deren Angebote jeder der 50.000 BI-Mitarbeiter frei nutzen kann und die inzwischen verknüpft sind mit dem Learning-Management- System (LMS) von Boehringer.
„Ein LMS ist ursprünglich für Administratoren gebaut worden, nicht in erster Linie für die User. Linkedin-Learning dagegen kommt mit einem ansprechenden Frontend daher“, sagt Dr. Karsten Gottke, Global Senior Manager People Growth bei Boehringer Ingelheim. Für die Zusammenarbeit mit Linkedin-Learning spreche ebenso, dass viele Mitarbeiter die Plattform schon privat nutzen, und die zahlreichen Sprachen, in denen die Lernangebote unterbreitet werden. Hinzu komme, dass LinkedinLearning aufgrund von Empfehlungen und anhand des individuellen Lernfortschritts, den die Plattform anzeige, personalisiert genutzt werden könne. „Daneben kuratieren wir selbst Lerninhalte und -pfade“, sagt Gottke.
Dabei spielen auch die Learning-Analytics-Funktionen von Linkedin-Learning eine Rolle. Beispielsweise bietet die Plattform die Möglichkeit, Nutzungsstatistiken zu erheben. Boehringer kann dann sehen, mit welchen Themen sich die Mitarbeiter befassen, wie viele Kurse besucht und in welchem Umfang sie abgeschlossen werden. „Nicht zuletzt wird auch analysiert, welche Aufmerksamkeit Lernkampagnen von BI erzielen“, so Gottke. „Und wir können mithilfe der Analytics-Funktionen eigene Trainingsangebote zielgenau anbieten.“
Learning Analytics: Systemoptimierung oder pädagogische Unterstützung?
Auch I-Moox bietet Learning-Analytics-Funktionen. Hier erhalten die Lernenden auf der Basis anonymisierter Daten Informationen darüber, wie engagiert sie im Vergleich zu anderen Lernenden sind und wie ihre Noten im Feld einzuordnen sind. Die Lehrenden werden
informiert, wie ihr Kurs „performt“ (wie oft etwas gelesen wird, welche Videos wie lange angeschaut werden etc.). Geht es um die Analyse von Daten im Kontext von Lernen, legt Ebner von der TU Graz Wert auf eine nicht nur akademische Unterscheidung: Educational Data Mining (EDM) versus Learning Analytics (LA).
Während bei EDM vor allem intelligente Lernsysteme entwickelt und optimiert würden, stünden bei LA der Lehrende und die Lernenden im Mittelpunkt, erklärt Ebner. LA sei dann sinnvoll, „wenn die Datenlage umfassend, die Algorithmen valide und die Interpretation durch Lehrende und Lernende ausreichend möglich ist“, so Ebner.
Vorhersagen mittels Analytics, beispielsweise anhand der Daten von erfolgreichen Lernenden, besagten lediglich, es könnte für eine bestimmte Person schwer werden, den nächsten Lernschritt erfolgreich zu absolvieren. Das heiße aber nicht, als Lernender auf den nächsten Kurs verzichten oder aus einem Lernpfad aussteigen zu müssen, sondern könne auch bedeuten, sich – statt auf drei – nur auf eine Prüfung zu konzentrieren. „Es ist wichtig, nicht den pädagogischen Kontext zu verlassen“, sagt Ebner.
(Stand: 9 / 2019)
Der Beitrag ist in voller Länge im Personalmagazin (Heft 12 / 2019) erschienen.